Ich machte kürzlich bei der #2009vs2019-Challenge mit – als ich durch alte Fotoalben schaute, fiel mir zum ersten Mal selbst so richtig auf, wie sehr ich mich in den vergangenen Jahren veränderte. Auf einer englischen Seite wird mein Foto unter der Überschrift „22 People From #10YearChallenge Who Have Changed Beyond Recognition“ auf Platz 4 geführt. Dazu schreiben die Autoren und Autorinnen: But if you look at the photos marked with #2009vs2019 you’ll realize that some people have not only grown older, lost weight, or changed their hair color, it seems that they have been literally reborn. So, looking at their photos you just want to exclaim, “I can’t believe that’s the same person!”

Und tatsächlich fühlt sich mein Leben in den vergangenen Monaten wie eine Wiedergeburt an – oder vielleicht sogar: wie eine Neugeburt. Seit bald einem Jahr nehme ich Testosteron und seitdem hat sich vieles bei mir verändert und viele dieser Veränderungen machen mein Leben mittlerweile deutlich erträglicher und glücklicher.
Zunächst bekam ich das Testosteron als Depotspritze alle 6 Wochen, mittlerweile ist der Abstand zwischen den Spritzen größer geworden – nun gehe ich alle elf Wochen zum Endokrinologen, um mir die nächste Dosis Testosteron spritzen zu lassen. Das Testosteron bekomme ich als ölige Lösung in den Gesäßmuskel gespritzt – das ist schmerzhaft, aber aushaltbar. Bei jedem zweiten Termin, wird mir außerdem Blut abgenommen, um zu überprüfen, wie hoch mein Testosteronspiegel ist und wie der restliche Körper die Hormonzufuhr verträgt. Die Veränderungen der letzten 12 Monate haben sich stets schrittweise bemerkbar gemacht: bereits nach einigen Wochen befand ich mich im Stimmbruch, später begann sich meine Klitoris spürbar zu verändern – sie schwoll zu einem kleinen Mini-Penis heran. Was hat sich noch getan? Die Körperfettverteilung verändert sich: ich habe fast eine Körbchengröße Brustumfang verloren. Stattdessen sprechen mich viele auf meine breiten Schultern an und fragen, ob ich denn trainiere, um so fit auszusehen.
Was die Hormone psychisch mit mir machen, ist schwer zu sagen. Ich merke, dass meine Stimmung am Ende eines Intervalls häufig kippt: im Laufe der zehnten Woche bin ich oft müde, antriebslos und gereizt, und ich werde schneller krank als sonst. Ansonsten habe ich kürzlich die ersten Barthaare über meiner Oberlippe entdeckt – seit vier Wochen nehme ich Minoxidil, um den Bartwuchs zu beschleunigen. Bisher leider noch ohne große Erfolge, aber auch ohne gravierende Nebenwirkungen.









Ich bin gespannt darauf, welche Veränderungen das zweite Jahr Testosteron so mit sich bringen werden. Was ich in den vergangenen 12 Monaten gemerkt habe: dass ich mich sehr viel mit mir selbst, mit den Veränderungen meines Körpers und meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen beschäftige. Zwischendurch muss ich immer aufpassen, nicht nur in meinem Kopf zu sein, sondern auch zu leben. Wenn ich zurückblicke auf diesen Menschen, der im Rock und etwas verloren im Wald steht, wünschte ich, ich könnte erklären, was eigentlich genau zu meiner Neugeburt führte. Aber ich kann es nicht wirklich – es war eine Mischung vieler Faktoren: ich überwand ganz viel Scham und Angst und hatte dabei tolle Unterstützung. Als ich zum ersten Mal meinen Linus-Becher zeigte, konnte ich noch mit niemandem darüber sprechen. Aber ich wohnte bei zwei Menschen, die das Foto des Bechers im Internet sahen und danach meinen Namen auf ihrem Klingelschild änderten – ohne Nachfragen und ohne den Wunsch nach Erklärungen. Danach outete ich mich auf der Arbeit, anschließend fand ich eine Therapeutin und im Februar 2018 begann ich damit, Hormone zu nehmen. Ich hatte viel Glück bei meinem Weg bisher und hoffe, dass meine Wünsche auch 2019 in Erfüllung gehen.
Aber es gibt auch immer noch Baustellen: ich möchte lernen, selbstbewusster aufzutreten. Ich möchte an meiner Körperhaltung arbeiten, an meiner Selbstsicherheit. Ich fühle mich tagtäglich wohler mit meinem Körper, kann mir aber nicht vorstellen jemanden zu finden, der sich mit mir wohl fühlen könnte. Es fehlt mir an Selbstvertrauen, vor allem auch an Vertrauen in meine eigenen Impulse, Bedürfnisse und Wünsche. Es liegt noch viel Arbeit vor mir, aber das fühlt sich gerade eigentlich ganz okay an.


 Ich habe bisher den Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt und werde nun die nächsten Schritte in Angriffe nehmen, über die ich euch hier gerne weiterhin auf dem Laufenden halten kann.
Ich habe bisher den Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt und werde nun die nächsten Schritte in Angriffe nehmen, über die ich euch hier gerne weiterhin auf dem Laufenden halten kann.
 Es ist fast acht Monate her, dass ich online zum ersten Mal zur
Es ist fast acht Monate her, dass ich online zum ersten Mal zur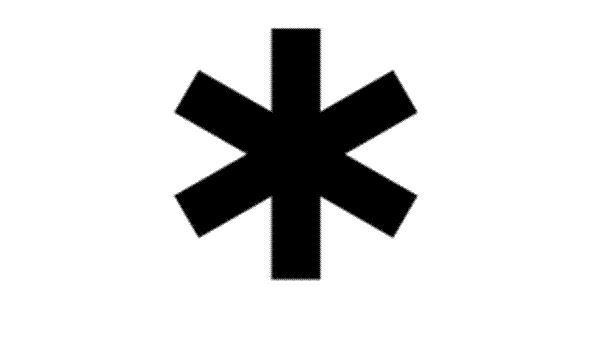






 Lange Zeit wusste ich nicht, dass die Klitoris durch die Hormone wachsen wird – bis ich an mir selbst Veränderungen feststellte und erst einmal sprachlos war. Welches Ausmaß das Wachstum hat, ist bei jedem trans Mann unterschiedlich. In der Regel wächst die Klitoris zwischen drei und sieben Zentimentern. Als ich auf Twitter von meinem neuen Minipenis erzählte, erfuhr ich, dass es dafür sogar einen Begriff gibt – Pentoris. Im englischen Sprachraum sprechen viele trans Männer auch vom t(estosterone) dick, also dem Testosteron Penis.
Lange Zeit wusste ich nicht, dass die Klitoris durch die Hormone wachsen wird – bis ich an mir selbst Veränderungen feststellte und erst einmal sprachlos war. Welches Ausmaß das Wachstum hat, ist bei jedem trans Mann unterschiedlich. In der Regel wächst die Klitoris zwischen drei und sieben Zentimentern. Als ich auf Twitter von meinem neuen Minipenis erzählte, erfuhr ich, dass es dafür sogar einen Begriff gibt – Pentoris. Im englischen Sprachraum sprechen viele trans Männer auch vom t(estosterone) dick, also dem Testosteron Penis.

 Im Anschluss an ihren Auftritt, erschienen in denen deutschen Medien zahlreiche Artikel über Chelsea Manning und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:
Im Anschluss an ihren Auftritt, erschienen in denen deutschen Medien zahlreiche Artikel über Chelsea Manning und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:



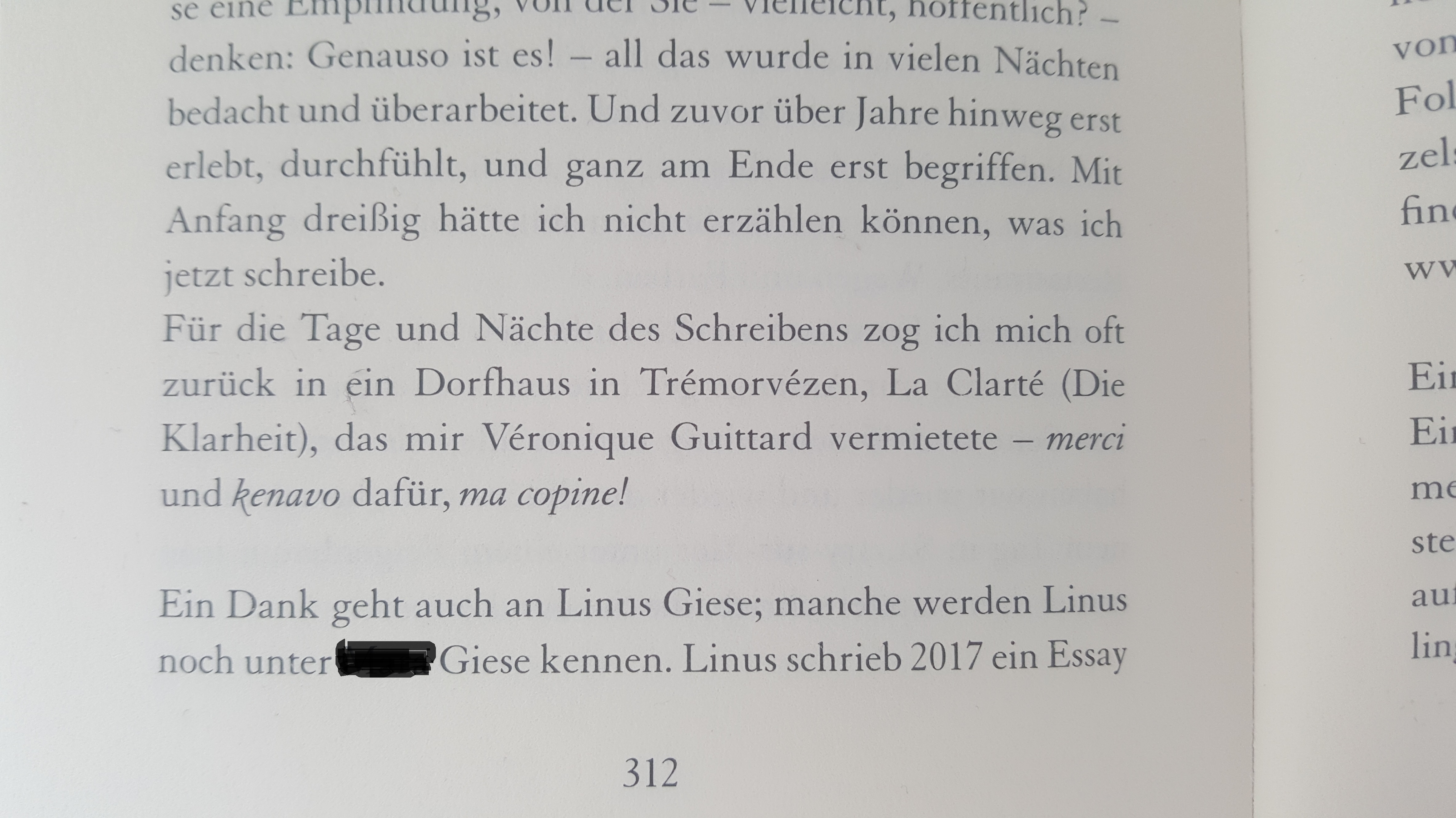





 Was mich selbst Mut gekostet hat, war mein Coming-Out. Es hat mich Mut gekostet, im Starbucks zum ersten Mal Linus zu sagen. Es hat mich Mut gekostet, mein erstes Herrenhemd zu kaufen. Es hat mich Mut gekostet, meinen Blogbeitrag zu veröffentlichen. Aber es kostet mich keinen Mut, dieses Leben jetzt zu leben. Ich freue mich, wenn ihr mir Komplimente für meine Kleidung macht. Ich freue mich über Komplimente für meine Frisur. Ich freue mich, wenn euch das alles nicht interessiert und ihr mit mir einfach nur über Bücher sprechen wollt. Aber ich möchte wirklich nicht mehr hören, dass ich mutig bin. Ich möchte weder mutig noch inspirierend sein, ich möchte einfach nur mein Leben leben.
Was mich selbst Mut gekostet hat, war mein Coming-Out. Es hat mich Mut gekostet, im Starbucks zum ersten Mal Linus zu sagen. Es hat mich Mut gekostet, mein erstes Herrenhemd zu kaufen. Es hat mich Mut gekostet, meinen Blogbeitrag zu veröffentlichen. Aber es kostet mich keinen Mut, dieses Leben jetzt zu leben. Ich freue mich, wenn ihr mir Komplimente für meine Kleidung macht. Ich freue mich über Komplimente für meine Frisur. Ich freue mich, wenn euch das alles nicht interessiert und ihr mit mir einfach nur über Bücher sprechen wollt. Aber ich möchte wirklich nicht mehr hören, dass ich mutig bin. Ich möchte weder mutig noch inspirierend sein, ich möchte einfach nur mein Leben leben.